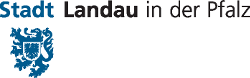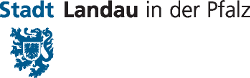Wieso? Weshalb? Warum?
Das große Ziel ist die Treibhausgasneutralität! Hierfür müssen langfristige und strategische Entscheidungen vorbereitet, mit den relevanten Akteurinnen und Akteuren der Wärme- und Stadtplanung diskutiert und von den städtischen Gremien beschlossen werden. Konkret geht es darum, wie die Wärmeversorgung in Landau künftig organisiert bzw. umgebaut werden soll und welche Infrastrukturen dafür notwendig sind. Dieser Prozess wird als Kommunale Wärmeplanung bezeichnet. Ergebnis des Ganzen wird ein Konzeptpapier sein. Darauf aufbauend werden die Planungen für die künftige Wärmeversorgung konkretisiert und dann auch von den Versorgungsunternehmen umgesetzt.
Gesetzliche Grundlage
Im August 2023 wurde vom Bundeskabinett der "Entwurf des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze" beschlossen. Nach der Beschlussfassung durch den Bundestag im November 2023 steht nun noch die Verabschiedung des Gesetzes durch den Bundesrat aus. Anschließend soll das Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten.
Mit dem Gesetz wird den Ländern die Aufgabe übertragen, für ihre Gebiete verpflichtend eine Wärmeplanung durchzuführen. Entsprechend ihrer Zahl an Einwohnerinnnen und Einwohnern müsste die Stadt Landau ihren Kommunalen Wärmeplan erst im Jahr 2028 beschließen. Da sich die Stadt jedoch dem Ziel der Bundesregierung verpflichtet hat, den Gebäudebestand bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral mit Wärme zu versorgen, wird diese Aufgabe bereits frühzeitig als freiwillige Selbstverpflichtung und als Beitrag zum aktiven Umweltschutz angegangen.
Partnerschaft
Die Energie- und Wärmewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Kommunen, Versorgungsunternehmen und auch weitere lokale Akteurinnen und Akteure werden Hand in Hand zusammenarbeiten, um die Generationenaufgabe Wärmewende erfolgreich zu gestalten. Die Stadt arbeitet hier sehr eng mit der EnergieSüdwest AG (ESW) als lokaler Energieversorgerin zusammen. Daher wird auch die ESW die Bürgerinnen und Bürger - zusätzlich zu dem von uns als Verwaltung bereitgestellten Informationsangebot - über die Umsetzungsstrategie informieren.
Was beinhaltet der Wärmeplan?
Die Kommunale Wärmeplanung für Landau zeigt einen strategischen und schrittweisen Weg zur erneuerbaren Wärmeversorgung auf - sie ist quasi ein Fahrplan für das künftige Vorgehen. Denn die Ergebnisse und Handlungsvorschläge der Planung dienen dem Stadtrat, der Verwaltung, den Energieversorgern und allen weiteren Beteiligten als Grundlage für die weitere Stadt- und Energieplanung.
Die Kommunale Wärmeplanung lässt sich in vier Schritte unterteilen:
1. Bestandsanalyse
Im ersten Schritt erfassen wir den aktuellen Wärmebedarf und -verbrauch und die daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen, analysieren die vorhandenen Gebäudetypen und das Baualter sowie die bestehende Infrastruktur der Wärmeversorgung und die Beheizungsstruktur der Gebäude.
2. Potenzialanalyse
Als nächstes ermitteln wir die Einsparpotenziale für Raumwärme in Haushalten, in Gewerbebetrieben, im Handel und in Dienstleistungsbetrieben, in der Industrie und in öffentlichen Liegenschaften. Dabei wird vor allem untersucht, wo und wie in Landau erneuerbare Energien, Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung eine klimaneutrale Wärmeversorgung ermöglichen können.
3. Zielszenario
Anschließend entwickeln wir Szenarien, wie der zukünftige Wärmebedarf bis 2045 klimaneutral gedeckt werden kann. Dazu gehört eine räumlich aufgelöste, in Quartiere eingeteilte Darstellung der Versorgungsstruktur im Jahr 2045 mit dem Zwischenziel 2030. Dabei berücksichtigen wir geeignete Gebiete für Wärmenetze und dezentrale Versorgung. Und wir formulieren gemeinsam mit der EnergieSüdwest AG einen Plan zur Umsetzung des Kommunalen Wärmeplans, inklusive Prioritäten und Zeitrahmen für den Aufbau der zukünftigen Energieversorgung.
4. Wärmewendestrategie
Abschließend beschreiben wir erste konkrete Maßnahmen für die Erreichung der erforderlichen Energieeinsparung und den Aufbau der zukünftigen Energieversorgungsstruktur.
Der Wärmeplan wird durch den Beschluss der städtischen Gremien für die Verwaltung verbindlich. Das bedeutet, dass sich öffentliche Projekte und Baumaßnahmen an die Ergebnisse der Wärmeplanung halten müssen. Im Entwurf für das Wärmeplanungsgesetz gibt es bislang keine Vorschrift, die besagt, in welchem Zeitraum nach Erstellen der Wärmeplanung ein Beschluss über die Ausweisung für ein Wärme- oder Wasserstoffnetzgebiet zu treffen ist. Eine Stadt kann also zunächst eine Wärmeplanung erstellen und sich anschließend Zeit damit lassen, konkrete Entscheidungen über Netzgebiete zu treffen.
Die Stadt Landau beabsichtigt allerdings nicht, eine Wärmeplanung "für die Schublade" zu erstellen. Wir arbeiten parallel bereits an konkreten Umsetzungsmöglichkeiten.
Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Wärmeplan nicht rechtsverbindlich. Das heißt, es können keine Forderungen zum Netzausbau oder zum Anschluss an Versorgungsnetze gestellt werden. Gleichzeitig müssen die Bürgerinnen und Bürger aber auch nicht selbst handeln und z.B. ihre Heizungen umbauen (Mehr Infos hierzu gibt es auch bei der Frage zu den gesetzlichen Verpflichtungen).
Am Ende des Prozesses haben die Bürgerinnen und Bürger aber deutlich mehr Klarheit über die zukünftigen Möglichkeiten ihrer Wärmeversorgung. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können somit besser planen, welche Investitionen in die Energieversorgung zu welchem Zeitpunkt für sie am sinnvollsten sind, da z.B. klar wird, ob und wann ihr Eigentum oder Mietshaus an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.
Wie läuft die Datenerhebung?
Welche Daten werden erhoben?
Zur Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung werden Daten in großen Umfang gesammelt. So werden unter anderem die Energieverbräuche von Gebäuden erhoben sowie Informationen zu Wärmeerzeugern und zu geschützter Bausubstanz. Bei industriellen, gewerblichen oder sonstigen Unternehmen, die Wärme einsetzen, werden auch Informationen zum Prozesswärme- und zum Endenergieverbrauch sowie Art der Wärmeerzeugung erhoben.
Für die Wärmeplanung der Stadt Landau werden Daten von den Betreibern von Energieversorgungs- und Wärmenetzen, Industrieunternehmen und Großkunden sowie von den Bezirksschornsteinfegern erhoben. Die Daten liegen den Betreibern ohnehin vor und werden für die Bestandsanalyse genutzt.
Nein. Alle Daten werden über Baublöcke zusammengefasst und nur in aggregierter Form veröffentlicht. Das heißt, dass mindestens fünf beheizbare Gebäude als Einheit zusammengefasst werden, so dass keine Rückschlüsse auf Einzelgebäude gezogen werden können. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. Die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten, insbesondere der Schutz gebäudebezogener Daten, ist uns wichtig und wird uneingeschränkt beachtet.
Wie stehen gesetzliche Verpflichtungen des Gebäudenenergiegesetzes (GEG) zeitlich zur Kommunalen Wärmeplanung? Wie sieht die Verzahnung von GEG-Novelle mit dem Wärmeplanungsgesetz konkret aus?
Sowohl die GEG-Novelle als auch das neue Gesetz für die kommunale Wärmeplanung sollen zeitgleich zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Das Gesetz schreibt in § 71 Abs. 1 zu den Anforderungen an Heizungsanlagen vor, dass neue Heizungen in Neubaugebieten mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen müssen. Für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt die 65% erneuerbare Energien Pflicht erst mit Ablauf der Fristen für die Erstellung der Wärmeplanung, d.h. für Landau erst ab 30.06.2028.
Aber: Die Wärmeplanung allein löst die frühere Geltung der Pflichten des GEG nicht aus. Es braucht eine zusätzliche Entscheidung der Kommune über die Ausweisung als "Gebiet zum Neubau eines Wärmenetzes" oder als "Wasserstoffnetzausbaugebiet", die veröffentlicht sein muss.
Nähere Infos und häufige Fragen und Antworten zum Gebäudeenergiegesetzes finden sich hier.
Besteht eine Anschlusspflicht an künftige Fernwärmenetze?
Derzeit ist keine Anschlusspflicht an künftige Fernwärmenetze geplant.
Aber: Es besteht eine Verpflichtung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Gebäude zu bestimmten Zeiten nur noch mit erneuerbaren Energien zu wärmen. Nach heutigem Stand muss 2045 die Nutzung fossiler Energien beendet sein.
Gibt es pro Straße nur eine Wärmequelle?
Voraussichtlich ja, wenn damit die Wärmequelle aus dem öffentlichen Raum gemeint ist. Es wird aus wirtschaftlichen Gründen und dem begrenzten Platz im Straßenraum nach aktuellem Stand nur eine Fernwärmeleitung geben können und kein alternatives Netz. Wie und wann ein tatsächlicher Umbau vollzogen wird, ist aber keine Entscheidung der Kommunalen Wärmeplanung, sondern der anschließenden Umsetzung. Der Kommunale Wärmeplan ist nur die Vorbereitung, liefert Erkenntnisse und dient als Entscheidungsgrundlage.
Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch dezentrale individuelle Energiequellen, wie z.B. Wärmepumpen, PV-Anlagen, Biomasse etc. genutzt werden können.
Was wird in den Straßen aktuell vorbereitet?
Bei laufenden Baustellen werden von der EnergieSüdwest AG bereits Fernwärmeleitungen mitverlegt, um Kosten zu sparen und die Straßen später nicht erneut aufgraben zu müssen. Das mögliche Rohrleitungsnetz und die erforderlichen Dimensionen werden derzeit geplant. Es erfolgt aber noch kein Rückbau von Gasleitungen oder -hausanschlüssen, wenn die Fernwärme noch nicht lieferbar ist.
Erfolgt auch für die Landauer Stadtdörfer eine Wärmeplanung?
Ja, die Kommunale Wärmeplanung umfasst das gesamte Landauer Stadtgebiet - also auch die acht Stadtdörfer.