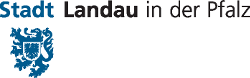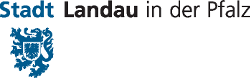Stadt Landau startet nächste Ausbringung von Kieselgur zur Eindämmung von Tapinoma magnum
Es geht in die nächste Runde: Wie bereits im August, bringt die Stadt Landau erneut das biologische Mittel Kieselgur auf stark betroffenen öffentlichen Flächen aus, um der Ausbreitung der Ameisenart Tapinoma magnum entgegenzuwirken.
Beginn ist am Donnerstag, 18. September, auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule Landau in der Pfalz.
Im Anschluss folgen Maßnahmen in Landau-Nord sowie den Stadtteilen Mörzheim und Arzheim.
In der kommenden Woche geht es ab Montag, dem 22. September, in Landau-Süd und Landau-West weiter, bevor Mitte der Woche auch in Godramstein Kieselgur ausgebracht wird.
In jüngster Zeit häufen sich in Landau Beobachtungen ungewöhnlich aktiver Ameisen. Besonders auffällig ist dabei das verstärkte Auftreten der Art Tapinoma magnum, die inzwischen in mehreren Bereichen der Kernstadt sowie im Stadtdorf Godramstein gesichtet oder vermutet wird. Ihr Vorkommen auf Gehwegen, Spielplätzen, in Gärten und Häusern sorgt vielerorts für Verunsicherung. Um dem zu begegnen, unterstützt die Stadt Landau betroffene Bürgerinnen und Bürger jetzt aktiv.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass sich Tapinoma magnum bei Ihnen angesiedelt hat, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Selbst bestimmen – mit unserer Anleitung
Nutzen Sie gerne unsere Bestimmungshilfe weiter unten auf der Seite, um die Ameise selbst zu identifizieren! Dort finden Sie auch, ein FAQ mit häufig gestellten Fragen rund um Tapinoma magnum.
2. Sie sind sich unsicher? – Wir helfen weiter
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist wichtig zu unterscheiden:
- Öffentliche Fläche:
Nutzen Sie bitte den Mängelmelder der Stadt Landau und wählen Sie dort die Kategorie „Ameisen“. Geben Sie möglichst genau an, wo Sie Tapinoma magnum vermuten.
So kann das Umweltamt eine Übersichtskarte erstellen, um das Ausmaß der Ausbreitung in Landau besser zu erkennen.
Die Karte finden Sie ebenfalls weiter unten verlinkt. - Private Fläche:
Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an ameise@landau.de mit folgenden Angaben: Ihr Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Wir prüfen dann, ob das Vorkommen bereits vom Umweltamt erfasst wurde. Falls nicht, setzten wir uns mit Ihnen in Verbindung, um einen Termin für eine Vor-Ort-Begehung zu vereinbaren.
3. Noch Fragen?
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne an unsere Ansprechpersonen wenden. Die Kontaktdaten finden Sie an der Seite bzw. bei der Handydarstellung unten.
Wo lebt sie am liebsten?
Die Tapinoma magnum fühlt sich besonders wohl an warmen, sonnigen und trockenen Orten – zum Beispiel unter Pflastersteinen auf sandigem Boden. Wiesen und Gärten auf lehmigen Böden mit viel Grün meidet sie eher.
Wie riecht sie?
Wenn man diese Ameisen zerdrückt, riechen sie auffällig – nach ranziger Butter, Zitrusfrucht oder Nagellack (Aceton). Unsere heimischen Ameisen riechen beim Zerdrücken meist gar nicht.
Wie sieht sie aus?
Die Ameisen sind schwarz, haben eine kleine Kerbe am Kopf und sind zwischen 2 und 3.5 Millimeter groß. Bei Tapinoma magnum unterscheiden sich die Arbeiterinnen oft in der Größe – sie sind also nicht alle gleich lang. Sind alle Ameisen in einer Kolonie gleich groß, handelt es sich wahrscheinlich um eine heimische Art.
Wie bewegen sie sich?
Unsere heimischen Ameisen laufen meist in schmalen, einspurigen Straßen. Tapinoma magnum dagegen bildet breite "Ameisen-Autobahnen", auf denen viele Tiere nebeneinander unterwegs sind.
Wie verhalten sie sich?
Stochert man mit einem Stock im Ameisennest, verteidigen sich die Tiere und greifen den Stock an. Unsere heimischen Ameisen bleiben dabei meist gelassen und verkriechen sich.
Wie sehen die Ameisenbabys (Ameisenpuppen) aus?
Tapinoma magnum hat sogenannte Nacktpuppen – sie bilden keinen Kokon. Man kann an den Puppen bereits kleine Beinchen erkennen. Die Eier und Puppen sind weiß und durchsichtig.
Verbreitung vermeiden:
Über Topfpflanzen können Ameisen unbemerkt in neue Gärten oder Quartiere gelangen – und sich dort schnell ausbreiten. Damit sich die Ameisenart Tapinoma magnum nicht weiter ausbreitet, ist Ihre Mithilfe gefragt. Achten Sie deshalb besonders auf folgende Punkte:
- Pflanzen vor dem Kauf sorgfältig prüfen:
Schauen Sie sich die Pflanze genau an – besonders den Topfbereich! Wenn dort oder im Wurzelbereich Ameisen in großer Zahl zu sehen sind, ist Vorsicht geboten.
Tipp: Kaufen Sie keine Pflanzen, die bereits von Tapinoma-Ameisen befallen sind. - Auch bei geschenkten Pflanzen aufpassen:
Bekommen oder verschenken Sie Pflanzen? Dann prüfen Sie bitte vorher ebenfalls, ob sich darin Ameisen befinden.
Warum Eindämmung?
Erfahrungen aus anderen Kommunen und Städten zeigen, dass man Tapinoma magnum nicht vollständig los wird.
„Sie sind gekommen, um zu bleiben“.
Viel mehr kann man versuchen mit verschiedenen Maßnahmen, ihre Population einzudämmen.
Wie funktioniert die Eindämmung?
Für den Erfolg zur Eindämmung von Tapinoma magnum ist eine koordinierte Herangehensweise von der Stadt Landau und Bürgerinnen und Bürgern von hoher Relevanz. Die Stadt Landau nimmt Maßnahmen mit Hilfe von Kieselgur auf öffentlich betroffenen Flächen vor und bittet Anwohnende angrenzende Grundstücke um zeitgleiche Behandlung ihrer Grundstücke mit Kieselgur oder Heißwasser.
! Heißwassereinsatz bitte nur auf befestigten (versiegelten/geschotterten) Flächen !
Kurzfristig:
- Städtisch koordiniertes Vorgehen: Kieselgur Behandlung auf öffentlich stark betroffenen Flächen
Mittel- und langfristig:
- Bei baulichen Maßnahmen beispielsweise ameisensicheren Unterbau verwenden, also Splitt statt Sand.
- Mit anderen betroffenen Kommunen im Gespräch bleiben und deren lokale Erfahrungen mit einbeziehen.
Auf Freiflächen
Präventiv: Abschneiden von Futterquellen
- Mülltonnen sichern (Klebebänder, Kieselgur)
- Blattläuse bekämpfen
- Leimbarrieren an Bäumen
- Erhöhung der Diversität bei der Gartenbepflanzung und Gestaltung schafft Lebensraum für Konkurrenten (Blumenwiese statt Rasen, Staudenbeete statt Steingärten) oder Prädatoren (Beutegreifer/Räuber) (Bsp.: Ameisenjungfern)
Warum Biodiversität gegen invasive Ameisen hilft:
1. Erhöhte Konkurrenz :
In einem biodiversen Garten gibt es bereits viele einheimische Ameisenarten und andere wirbellose Tiere, die Ressourcen wie Nahrung und Lebensraum nutzen. Das macht es für invasive Arten schwerer, sich zu etablieren.
2. Mehr natürliche Feinde (Prädatoren):
Mit steigender Biodiversität steigt auch die Anzahl und Vielfalt natürlicher Feinde invasiver Ameisen. Diese können deren Population auf natürliche Weise regulieren.
3. Stabilere Nahrungsketten:
In vielfältigen Lebensgemeinschaften existieren komplexere Nahrungsbeziehungen. Invasive Arten können sich schlechter durchsetzen, wenn sie in bestehende Netzwerke schwer integrierbar sind.
4. Förderung ökologischer Nischenvielfalt :
In einem artenreichen Garten werden viele ökologische Nischen besetzt, was die Invasionsmöglichkeiten für fremde Arten weiter einschränkt.
Eine Übersicht über die wichtigsten Prädatoren (Ameisenfresser) aus dem Insektenreich, die durch Biodiversität gefördert werden, finden sie hier: Wichtigsten Prädatoren (Ameisenfresser)
Umweltschonende Maßnahmen:
- Behandlung mit Kieselgur und/oder Heißwasser (wenn Sie Anwohnende von einem stark betroffenen öffentlichen Gebiet sind, möglichst parallel zu den städtischen Maßnahmen auf den öffentlichen Flächen)
- Aufbringen von Nematoden
- Kreide/Kalk (lokal abwehrend)
Bauliche Maßnahmen:
- Pflastersteine und Wege in Mörtelbett oder Splitt legen
- Sand abgraben und mit Lehm/ organischen Material auffüllen
- Blumentöpfe etc. auf Füße/Ständer
- Blattlausarme, dichte Bepflanzung
In Innenräumen
- Die Ameisenstraße verfolgen und die Einstiegsstelle ins Haus verschließen (z.B. durch Barrieren aus Kieselgur/Vaseline legen und regelmäßig erneuern)
- Lebensmittel gut verpacken - Ameisen lieben süßes und fettiges Essen
- Hausmittel wie Essig, Zimt, Natron oder Zitronenschalen können eine kurzfristige Vertreibung ermöglichen
- Zugelassene Biozide (lokal und kurzfristig)
Was ist Kieselgur?
Kieselgur besteht aus fossilen Kieselalgen und wirkt mechanisch/physikalisch: Es zerstört die Schutzschicht der Ameisen und lässt sie austrocknen. Für Menschen und Haustiere ist Kieselgur unbedenklich, sollte jedoch nicht eingeatmet werden. Alle behandelten Flächen werden daher gut sichtbar gekennzeichnet.
Städtische Ausgabe auf öffentlichen stark betroffenen Flächen
Im August 2025 hat die Stadt auf besonders stark betroffenen öffentlichen Flächen das biologische Mittel Kieselgur ausgebracht. Diese Maßnahme wurde in Abstimmung mit Fachleuten geplant und diente der umweltverträglichen Eindämmung der eingeschleppten Ameisenart. Sollte eine Nachbehandlung mit Kieselgur erforderlich sein, wird diese in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern punktuell durchgeführt.
Zu den stark betroffenen öffentlichen Flächen, die behandelt wurden, gehören: Godramstein, Arzheim und Mörzheim und die Landauer Kernstadt (unter anderem LD-Nord und LD-Süd).
Einen genauen Überblick über die mit Kieselgur behandelten Flächen erhalten Sie in der Fundstellen-Karte von Tapinoma magnum.
Die Pressemitteilung zur Ausbringung von Kieselgur finden Sie hier: Zur Eindämmung von Tapinoma magnum: Stadt Landau bringt Kieselgur auf stark betroffenen öffentlichen Flächen aus
Anleitung Kieselgur für Privathaushalte
Da Tapinoma magnum nicht zwischen öffentlichen und privaten Flächen unterscheidet, ist eine zeitgleiche Vorgehensweise unerlässlich. Die Stadt bittet daher alle Eigentümerinnen und Eigentümer, ihre Privatgrundstücke möglichst zeitgleich mit Kieselgur oder heißem Wasser zu behandeln.
! Hier aber nur punktuell heißes Wasser auf Pflasterbelägen oder am Rand von befestigten Flächen über den Nestern im Untergrund einsetzen. Heißwasserbehandlung im Umfeld von Sträuchern, Bäumen oder Staudenpflanzungen zerstört und verbrüht das Wurzelwerk und schädigt die Pflanzen !
Nur durch paralleles Handeln lässt sich die Ausbreitung wirksam eindämmen.
Wichtig: Die Stadt darf rechtlich keine Maßnahmen auf Privatflächen durchführen, der Einsatz liegt in der Verantwortung der Grundstückseigentümer. Kieselgur kann speziell als Biozid gegen Ameisen im Fachhandel erworben werden. Beim Ausbringen sollte eine Schutzausrüstung, bestehend aus Atemschutz, Sicherheitsbrille und Handschuhen, getragen werden, um das Einatmen des Pulvers zu vermeiden. Nach dem Ausbringen bleibt der Staub am Boden und stellt keine Gefahr mehr dar.
Ausgebracht wird die Kieselgur in Pulverform und wird zerstäubt aufgetragen. Streuen Sie die Kieselgur dünn auf alle Bereiche, auf denen Tapinoma magnum Ameisen zu sehen sind:
- Im Bereich von Pflanzen, insbesondere an deren Stängelbasis
- Auf Sandauswürfe, auf Laufwege und Pflasterfugen.
- Bringen Sie Kieselgur nur bei nachhaltig-trockener Witterung aus und wiederholen Sie die Anwendung nach Regen
Warum wird aktuell so viel über die Ameisenart Tapinoma magnum gesprochen? Wie kann ich als Laie die Ameise erkennen? Antworten auf diese Fragen sind im einem FAQ zusammengefasst: FAQ
Der Landauer Mängel- und Ideenmelder ist seit Jahren eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Stadtverwaltung zu kontaktieren. Dort gibt es mit der Kategorie "Ameisenbefall" nun eine zentrale Meldemöglichkeit rund um das Thema Ameisen. Hier können Fragen gestellt oder über eine Standortsuche der genaue Ort eines vermuteten Befalls mit Tapinoma magnum bestimmt werden. Der Mängelmelder steht auch als kostenlose App Mängelmelder.de für iOS und Android Android zur Verfügung.

Rund 200 Interessierte folgten der Einladung von Oberbürgermeister Dominik Geißler in die Kinck'sche Mühle in Godramstein, um sich über Herkunft, Vorkommen und Verbreitung der Tapinoma magnum sowie über Ansätze zu deren Eindämmung und Bekämpfung zu informieren. Mit dabei: Vertreterinnen und Vertreter des städtischen Umweltamtes und Stadtbauamtes sowie die wissenschaftlichen Experten Dr. Manfred Verhaagh vom Naturkundemuseum Karlsruhe und Prof. Carsten Brühl von der RPTU in Landau.